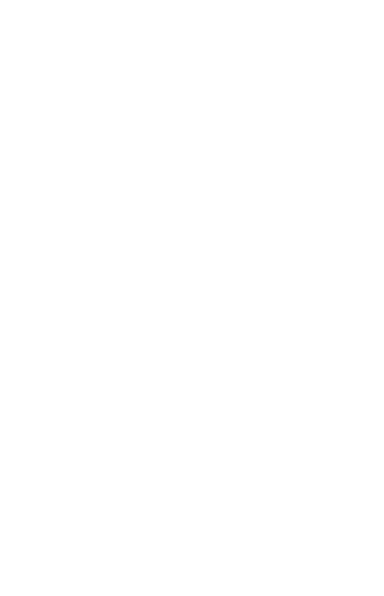Lignin: Das unterschätzte Biopolymer der Natur
Was ist Lignin?
Lignin ist ein faszinierendes Biopolymer, das in Pflanzen gebildet wird und mit einer jährlich neu entstehenden Menge von geschätzten 20 Gigatonnen das zweithäufigste natürlich vorkommende pflanzliche Polymer nach der Cellulose darstellt.
Der Begriff, der bereits Ende des 19. Jahrhunderts geprägt wurde, leitet sich vom lateinischen "lignum" (Holz) ab und verweist auf seine fundamentale Rolle in der Pflanzenwelt.
Vorkommen und Verbreitung
Das Lignin entsteht bei der Lignifizierung, auch Verholzung genannt, und beschränkt sich dabei nicht nur auf Bäume und Sträucher. Überraschenderweise erstreckt sich das Ligninvorkommen über Gräser, Einjahrespflanzen und sogar Algen. Der tatsächliche Anteil des Lignins an der Pflanzenmasse variiert erheblich zwischen verschiedenen Pflanzengruppen:
• Gymnospermien (Nadelbäume): ca. 30%
• Angiospermien (Laubbäume): ca. 20-25%
• Gräser und Einjahrespflanzen: < 20%
• Algen: ≤ 0,2%
Biologische Funktionen: Mehr als nur Stabilität
Während Cellulose primär für die Zugfestigkeit von Pflanzen verantwortlich ist, übernimmt Lignin eine Vielzahl wichtiger Funktionen:
Mechanische Eigenschaften
Ligninstrukturen sorgen für eine erhöhte Druckfestigkeit der Zellwand und ermöglichen es verholzten Pflanzen, entgegen der Schwerkraft hohe, schlanke Strukturen zu bilden. Diese einzigartige Kombination aus Druck- und Zugfestigkeit machte Holz über mehrere tausend Jahre zum wichtigsten Baustoff der Menschheit.
Schutzfunktionen
Lignin schützt die Pflanze vor dem Eindringen von Wasser und erschwert die mechanische Zerstörung durch Schädlinge. Zusätzlich bietet es Schutz vor UV-Strahlung und hemmt das Wachstum unerwünschter Mikroorganismen.
Technische Ligningewinnung
Die praktische Nutzung von Lignin erfordert dessen Gewinnung aus dem Pflanzengewebe. Jährlich fallen weltweit etwa 70 Millionen Tonnen technisches Lignin als Nebenprodukt der Zellstoff- und Papierindustrie an. Die wichtigste Ligninquelle der Nordhalbkugel stellen dabei Nadelgehölze aus bewirtschafteten Wäldern dar.

Sulfat-Verfahren
Das Sulfat-Verfahren, auch als Kraft-Verfahren bezeichnet, ist der weltweit dominierende Holzaufschluss-Prozess. Bei diesem alkalischen Verfahren wird Holz mit einer wässrigen Lösung aus Natriumhydroxid (NaOH) und Natriumsulfid (Na₂S) bei Temperaturen von 150-170°C und einem Druck von 8-10 bar über mehrere Stunden behandelt.

Sulfit-Verfahren
Das Sulfit-Verfahren basiert auf dem Einsatz von schwefeldioxidhaltigen Kochlaugen bei sauren bis neutralen pH-Werten (1,5-5,0). Der klassische saure Bisulfit-Prozess verwendet Magnesiumoxid als Basenkomponente und arbeitet bei Temperaturen von 130-140°C über 6-8 Stunden.

Alternative Verfahren
Neben den etablierten Methoden entwickeln sich zunehmend andere Prozesse wie der Sodaaufschluss für Nichthölzer oder das Organosolv-Verfahren, das besonders unveränderte, schwefelfreie Lignine liefert.
Anwendungen: Vom Brennstoff zum Hightech-Material
Energetische Nutzung
Mit einem Heizwert von etwa 27 MJ/kg besitzt Lignin den höchsten Energiegehalt aller natürlich vorkommenden Kohlenstoffpolymere. Diese thermische Nutzung sollte jedoch im Sinne der Nachhaltigkeit auf das Notwendigste beschränkt werden.
Chemische Synthese
Die bekannteste stoffliche Anwendung ist die Synthese von Vanillin. Die norwegische Firma Borregard erzielt eine Ausbeute von 3 kg Vanillin aus 1000 kg Holzausgangsmasse, wobei das Vanillin als Nebenprodukt des Sulfit-Prozesses aus Ligninsulfonat gewonnen wird.
Innovative Materialanwendungen
Carbonfaser
Eine vielversprechende, zukünftige Anwendung ist die Verwendung von Lignin als Rohstoff für die Carbonfaserherstellung. Da der Preis für Carbonfaserstoffe zur Hälfte auf deren teuren Ausgangsstoffen beruht, stellt Lignin eine kostengünstige Alternative dar.
Bauindustrie
Beispielsweise Ligninsulfonat in Beton hilft, temperaturbedingte Erosion zu minimieren und sorgt für niedrigere Aushärtungstemperaturen, was zu einer verbesserten Verarbeitung führt.

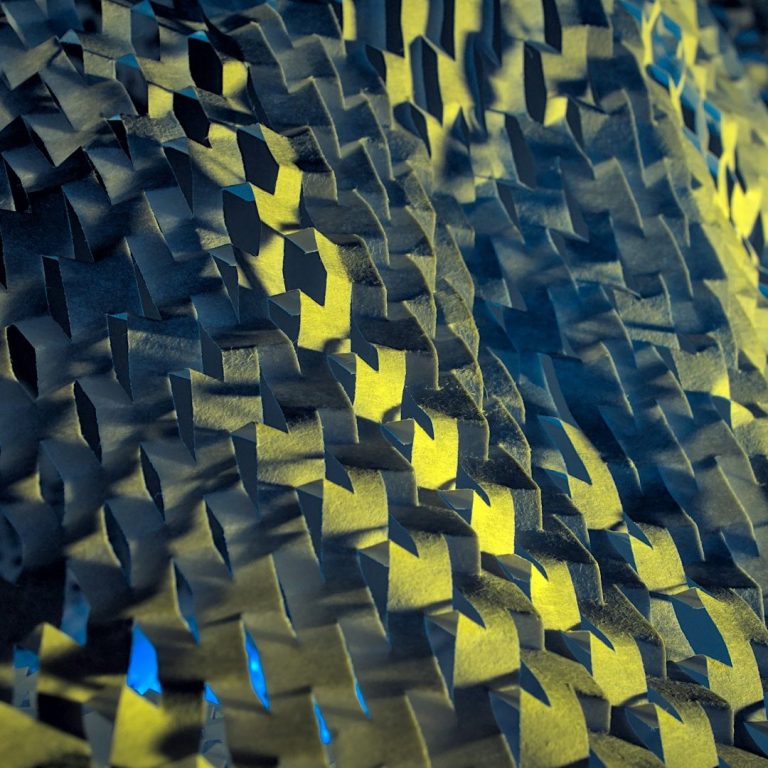
Polymere und Materialien
Auf Grundlage technischer Lignine lassen sich verschiedene synthetische Polymere herstellen, darunter Schäume, Klebstoffe und Hydrogele. Allerdings kann Lignin trotz seines Potentials noch nicht effektiv und kostengünstig zur Substitution erdölbasierter Produkte eingesetzt werden.
Medizinische und Pharmazeutische
Lignin zeigt als nicht-toxischer Antioxidant interessante Eigenschaften für medizinische Anwendungen u.a. Dermatologie, Antimikrobielle Stoffe, kontrollierte Wirkstofffreisetzung, Futtermittelzusätze.
Aktuelles

Schwermetallbindung
Eine bemerkenswerte Eigenschaft von Lignin ist seine Affinität zu Schwermetallen. Studien zeigen, dass Lignin eine natürliche Bindungskapazität zu Blei, Kupfer, Kadmium, Zink und Nickel aufweist. Diese Eigenschaft bildet ein chemisches Gleichgewicht, das von Faktoren wie Temperatur und Partikelgröße des Lignins beeinflusst wird.

Umweltaspekte
Darüber hinaus zeigen Lignin-basierte Hydrogele vielversprechende Eigenschaften für die Adsorption von Schweröl und anderen hydrophoben Kontaminanten.

Zukunftsperspektiven
Die Forschung an Lignin steht noch am Anfang ihres Potentials. Die Zukunft wird zeigen, ob es gelingt, die technischen Hürden zu überwinden und Lignin von einem Nebenprodukt zu einem wertvollen Rohstoff der Bioökonomie zu entwickeln.
Quellen und Hinweis
Diese kurze Darstellung verzichtet aufgrund der Lesbarkeit auf eine erschöpfende Quellenangabe. Die genauen Informationen sowie eine umfängliche Arbeit zum Thema kann über den Link oben eingesehen werden. Trotz allem seien hier in aller Kürze die wichtigsten Autoren
Vorkommen und Verbreitung
Crestini, Melone et al.: On the structure of softwood Kraft lignin (2011)
Boerjan et al.: Lignin biosynthesis (2003)
Dimmel: Overview of Lignin Chemistry (2010)
Sjöström: Wood Chemistry (1993)
Biologische Funktionen
Boerjan et al.: Lignin biosynthesis (2003)
Crestini, Melone et al.: On the structure... (2011)
Ralph et al.: Lignification: are lignins biosynthesized via simple combinatorial chemistry? (2004)
Technische Ligningewinnung / Aufschlussverfahren
Crestini et al.: Mild isolation of Kraft lignin (2015)
Blechschmidt: Taschenbuch der Papiertechnik (2006)
Fischer: Skriptum IPHC Tharandt
Gellerstedt: Kraft pulping (2009)
Anwendungen
Crestini, Melone et al.: On the structure... (2011)
Kadla et al.: Lignin-based carbon fibers (2002)
Vishtal & Kraslawski: Challenges in industrial applications of technical lignins (2011)
Glasser et al.: Lignin derivatives (1981)
Medizinische und pharmazeutische Anwendungen
Kai et al.: Biodegradable lignin nanoparticles (2016)
Kai et al.: Lignin-derived drug delivery systems (2018)
Gil-Chavez et al.: Technological applications of lignin in medicine (2017)
Umweltaspekte und Schwermetallbindung
Capanema et al.: Chemical structure of lignins (2004)
Lievonen et al.: Adsorption of metal ions by lignin-based materials (2001)
Sun et al.: Heavy metal ion adsorption using lignin (2017)
Zukunftsperspektiven / Forschung
Crestini et al.: Mild isolation of Kraft lignin (2015)
Argyropoulos: Quantitative 31P NMR analysis of lignins (1995)
Ralph et al.: Lignification... (2004)
Hoffmann, A.; Nong, J. P. et al.: Reactive and Functional Polymers (2020)