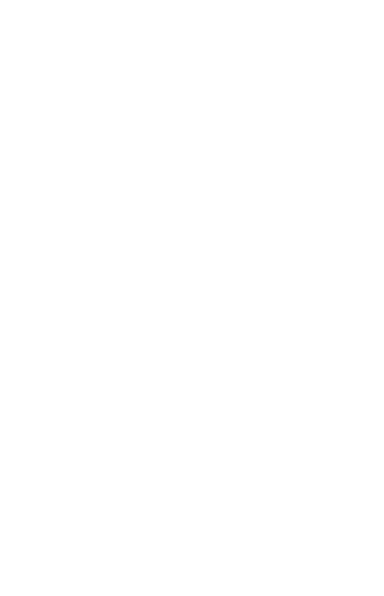Lignin
Lignin ist ein Biopolymer, das in Pflanzen gebildet wird. Mit einer jährlich neu entstehenden
Menge von geschätzten 20 Gigatonnen ist Lignin das zweithäufigste natürlich vorkommende
pflanzliche Polymer nach der Cellulose und vor den Hemicellulosen .
Der Begriff Lignin wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts geprägt und leitet sich von dem lateinischen lignum,
dem Wort für Holz, ab. Das Lignin entsteht bei der Lignifizierung, auch Verholzung der Pflanze
genannt. Dabei beschränkt sich das Ligninvorkommen nicht nur auf Bäume und Sträucher,
sondern erstreckt sich über Gräser, Einjahrespflanzen und Algen.
Im Gegensatz zur Cellulose, deren statische Aufgabe die Zugfestigkeit darstellt, sorgen
Ligninstrukturen für eine erhöhte Druckfestigkeit der Zellwand. Dies ermöglicht den verholzten
Pflanzen, entgegen der Schwerkraft hohe, schlanke Strukturen zu bilden. Diese Kombination
machte Holz über mehrere tausend Jahre zum wichtigsten Baustoff, da es sowohl Druck-, als
auch Zugkräfte aufnehmen kann.
Des Weiteren schützt das Lignin die Pflanze vor dem Eindringen von Wasser und erschwert
die mechanische Zerstörung durch Schädlinge. Auch der Schutz vor UV-Strahlung und die
Wachstumshemmung unerwünschter Mikroorganismen zählen zu den Funktionen von
nativem Lignin in der Pflanze.
Der tatsächliche Anteil des Lignins an der Pflanzenmasse variiert von Individuum zu
Individuum und ist nur schwer zu ermitteln. Jedoch gibt es Ähnlichkeiten bei verschiedenen
taxonomischen Klassen und Familien, wodurch für den jeweiligen Ligningehalt folgende, in
Richtwerte angenommen werden können:
Gymnospermien ca. 30 %
Angiospermien ca. 20-25 %
Gräser und Einjahrespflanzen < 20 %
Algen ≤ 0,2 %
Die wichtigste Ligninquelle der Nordhalbkugel stellen dabei im Moment Nadelgehölze aus
bewirtschafteten Wäldern dar. Im Zuge eines Holzaufschlusses wird die Holzstruktur in die
Polysaccharidstrukturen und Lignin zerlegt. Aufgrund der hohen Verfügbarkeit, der
Zellstoffqualität und Aspekten der Nachhaltigkeit von Einjahrespflanzen, werden
Aufschlussverfahren für Nicht-Hölzer angepasst und weiterentwickelt.
Ligningewinnung
Die tatsächlich untersuch- und isolierbaren technischen Lignine werden im Zuge eines
Aufschlusses gewonnen. Die größten Anwender dieser Techniken sind die Zellstoff- und
Papierindustrie, welche allerdings Cellulose und Hemicellulose weiterverarbeiten. Dabei fallen
jährlich weltweit etwa 70 Millionen Tonnen technisches Lignin (Stand 2008) als Nebenprodukt
an.
Um das Lignin chemisch, meist mit vorangegangener mechanischer Behandlung, von
Hemicellulosen und Cellulose zu trennen, wobei insbesondere Etherbindungen zur
Hemicellulose eine Rolle spielen, benötigt man Kenntnis über Depolymerisations- und
Derivatisierungsprozesse der Seitenkette und des aromatischen Ringes. Dieser kann
beispielsweise in acyclische oder nicht-aromatische Form überführt werden, was z.B. in der
Bleiche geschieht. Die Intensität des Aufschlusses bemisst sich an der geplanten
Verwendung des gewonnenen Zellstoffs.
Die weltweit bedeutendsten Methoden des Aufschlusses von Pflanzen sind das Sulfat- und
das Sulfit-Verfahren. Da in dieser Arbeit Lignin aus dem Sulfat-Verfahren zur Anwendung
gebracht wird, erfolgt eine gesonderte Behandlung dieses Prozesses.
Das Sulfitverfahren, meist die Varianz des sauren Bisulfit-Prozesses (pH-Wert 1,5-2,5) mit
Magnesiumoxid als Basenbestandteil, derivatisiert die PPEs zu Ligninsulfonaten, welche in
Wasser gelöst und so von der Cellulose getrennt werden können. Der Vorteil des Verfahrens
liegt in der Ablaugenrückgewinnung von Magnesiumoxid und dem Schwefeldioxid. Am Lignin
tritt eine Sulfonierung am Cα ein, wodurch sowohl die α-O-4-Bindung gespalten als auch
hydrophile Gruppen eingeführt werden. Das entstehende technische Lignin ist also
schwefelhaltig und wasserlöslich, da die entstehende Ligninsulfonsäure zumeist als Salz
vorliegt und gleichzeitig den polaren Charakter des Lignins stark erhöht. Bei diesem Verfahren
bleibt die dominante β-O-4-Bindung intakt.
Zu erwähnen ist außerdem, dass der Kerninhaltstoffes Pinosylvin, der vor allem in Kiefern,
Lärchen und Douglasien vorkommt, zu einer Kondensationsreaktion führt, wodurch der
Ligninabbau erschwert wird. Diese Holzarten werden folglich nicht für das Sulfitverfahren
eingesetzt. [33]. Neben Sulfit- und Sulfatverfahren etablieren sich zunehmend andere
Prozesse, die teilweise Lignin als Haupt- und nicht als Restprodukt gewinnen. Gerade für die
Behandlung von Nichthölzern wie Schilf, Stroh oder Bagasse eignet sich der Sodaaufschluss,
der dem Kraftverfahren ähnelt, jedoch bei geringeren Kochtemperaturen erfolgt und
schwefelfreie Sodalignine erzeugt.
Organische Lösemittel kommen im Organocell- und Organosolv-Verfahren zum Einsatz.
Speziell das Organosolv-Verfahren liefert recht unveränderte Lignine, die sich von den
gängigen technischen Ligninen stark unterscheiden, da sie nicht schwefelhaltig sind. Noch
erwähnenswert ist das Alcell- und das Acetosolv-Verfahren. Während beim Alcell dank hohem
Prozessdruck ebenso hohe Ligninausbeuten möglich sind, schwankt die Ligninqualität beim
Acetosolv in Abhängigkeit der eingesetzten Säurekonzentration
Technisches Kraft-Lignin
Technisches Kraft-Lignin hat wenig Ähnlichkeit mit seinem nativen Ausgangsstoff. Ein
gewonnenes Kraftlignin (Nadelholz, H-Faktor = 1700) wurde unlängst von CRESTINI ET AL.
näher untersucht. Die nach Depolymerisation vorliegenden Oligomere und Monomere führen
untereinander weitere Reaktionen innerhalb der Prozesszeit durch. Die aliphatischen
Seitenketten verarmen während des Prozesses. Stilbene, Aryl-Ether und Cinnamyle sind teils ungesättigte Strukturen, die bekanntermaßen aus dem
Kraftprozess resultieren. Dies verdeutlicht den Einfluss der Trennung der Aryl-
Etherbindung beim Aufschluss und zeigt den positiven Zusammenhang zwischen Lignin-
Löslichkeit bei steigendem Anteil phenolischer OH-Gruppen.
Anwendung von Lignin
Lignin hat einen Heizwert von ca. 27 MJ/kg, der höchste der natürlich vorkommenden
Kohlenstoffpolymere. In Anbetracht dessen, kann die thermische Nutzung von Lignin nicht
als ineffektiv und verschwenderisch gelten. Allerdings muss diese Verwendungsart im Sinne
der Lignin-Eigenschaft als Kohlenstoffsenke und der vielversprechenden alternativen
stofflichen Nutzungsformen auf das Notwendigste beschränkt werden.
Die populärste Methode der Ligninwertschöpfung ist die Synthese von Vanillin. Die gängigste
Methode aus Lignin synthetisches Vanillin herzustellen basiert auf der Methode von ROHDA.
Hierbei ist der Ausgangstoff Guajacol, welches durch elektrophile aromatische Substitution,
Oxidation und anschließender Decarboxylierung in Vanillin umgewandelt wird.
Die letzte praktizierende Firma Borregard erzielt eine Ausbeute von 3 kg Vanillin aus 1000 kg
Holzausgangsmasse. Hierbei wird jedoch ausgenutzt, dass Vanillin als Nebenprodukt des
Sulfit-Prozesses, also aus Ligninsulfonat, gewonnen werden kann.
Ligninnutzung ist auch bei deutlich geringerer Veränderung möglich. Als Futtermittel ist
Ligninsulfonat nicht nur Streckmittel sondern eine wertvolle Nahrungsergänzung gegen
intestinale Pathogene, deren Dosierung jedoch noch weiterer Forschung bedarf.
Ligninsulfonat in Beton kann helfen, temperaturbedingte Erosion zu minimieren und sorgt
allgemein für niedrigere Aushärtungstemperaturen und somit zu einer verbesserten
Verarbeitung.
Eine weitere populärer werdende Verwendungsmöglichkeit ist, Lignine als Rohstoff für die
Carbonfaserherstellung einzusetzen. In Anbetracht der Tatsache, dass der Preis für
Carbonfaserstoffe zur Hälfte auf deren teuren Ausgangsstoffen beruht, scheint Lignin ein
vielversprechendes Substitut für dessen Herstellung zu sein.
Andere, jedoch synthetische Polymere lassen sich auf Grundlage technischer Lignine
herstellen. Dazu zählen auch Schäume, Klebstoffe und die in dieser Arbeit beleuchteten
Hydrogele. Allerdings kann Lignin trotz seines Potentials im Bereich des Dämm-Schaums
noch nicht effektiv und kostengünstig verwendet werden um, Erdöl basierende Produkte zu
substituieren. Grund hierfür ist vor allem die Strukturinhomogenität und die
Reaktionsträgheit.
Kleinere Mengen Lignin können im medizinischen Bereich wertschöpfenden Prozessen
zugeführt werden. Lignin als nicht toxischer Antioxidant bildet einen interessanten
Ausgangsstoff für Haut- und Augenbehandlungen. Ebenfalls konnten antibakterielle und
antitumorale Eigenschaften bei Mäusen festgestellt werden. Des weiteren bilden Lignin–
Nanopartikel eine gute Grundlage für die pharmazeutische Wirkftoffbindung und deren
kontrollierte Abgabe.
Weniger stofflich, allerdings wertschöpfend energetisch kann Lignin in Bioraffinerien
eingesetzt werden. Es lässt sich über den pyrolytischen LIBRA-Prozess zu phenolischen Bio-
Kraftstoff und Koks umwandeln.
Zuletzt noch eine Eigenschaft die enge Verbindung zum Hintergrund vorliegender Arbeit
aufweist. Im Jahr 2008 konnte erneut gezeigt werden, dass Lignin eine Affinität zu Blei, Kupfer,
Kadmium, Zink und Nickel (in dieser Reihenfolge) aufweist. Diese Affinitäten bilden ein
chemischen Gleichgewicht, dass unter anderem von Temperatur, Partikelgröße des Lignins