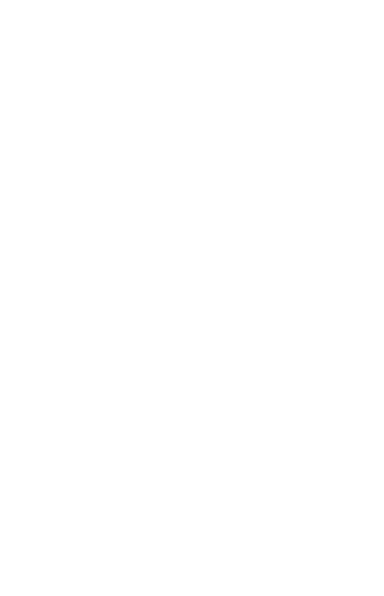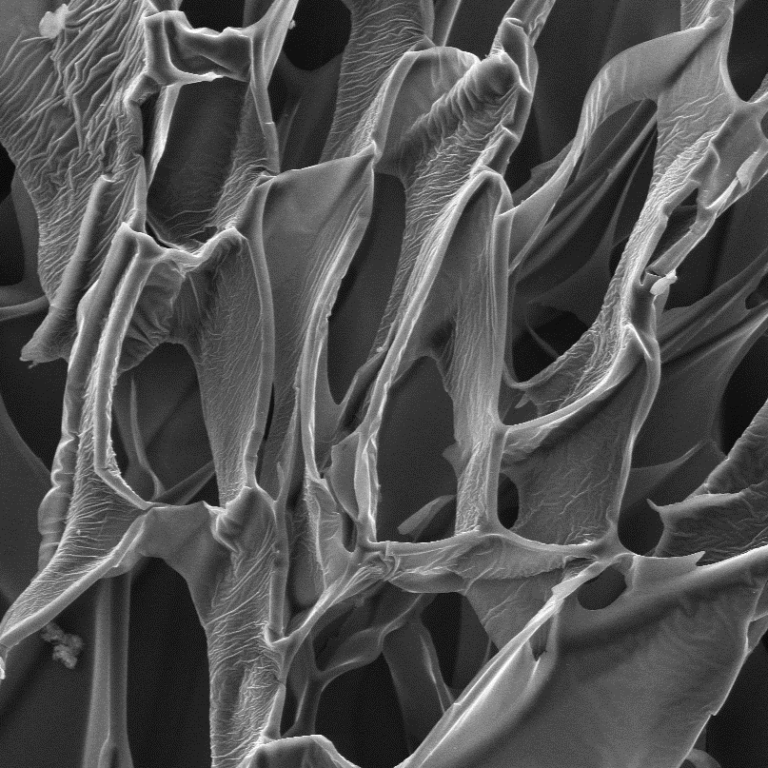
Hydrogele
Hydrogele im Speziellen sind dreidimensionale Polymere, die aufgrund funktioneller Gruppen
befähigt sind, Wasser in der Gelmatrix zu speichern, ohne sich dabei selbst im Wasser zu
lösen. Um erfolgreich ein Gel zu synthetisieren, muss ein Vernetzungsgrad erreicht
werden, bei dem das Polymer trotz löslicher Monomere nicht mehr löslich ist. Dieser wird als
Gelpunkt bezeichnet. Eben durch diese Vernetzungsreaktion entstehen sowohl kovalente,
als auch nicht-kovalente Bindungen zwischen den Monomeren.
Ligninhydrogele
Ein stabiles quellfähiges Hydrogel mit Lignin als Grundbaustein herzustellen ist möglich. Am
IPHC der TU Dresden erweiterte PASSAUER den Ansatz von NISCHIDA, URAKI&SANO, Lignin
mit Natronlauge vorzubehandeln, um den Einsatz von Wasserstoffperoxid und Fentons
Reagenz. Die Folge ist eine Hydroxilierung sowohl der aliphatischen als auch der
aromatischen Bereiche der PPEs. PASSAUER spricht hier treffend von „Ankerpunkten“ für die
Vernetzungsreaktion. Insbesondere bei Kraftligninen erfolgt diese mit Polyethylenglucol-
diglycidyl-ether (PEGDGE).
Je stärker das Gel vernetzt ist, desto höher ist die Elastizität und ebenso
die mechanische Widerstandskraft. Die Vernetzungsintensität ist bislang die
einflussreichste Stellschraube für die Eigenschaften eines Ligninhydrogels. Stabilität und
Quellfähigkeiten sind als gegensätzliche Eigenschaften der Ligninhydrogele anzusehen
Quellfähigkeit und FSC
Der Quellfähigkeit (FSC) von Kraftligninhydrogelen schwankt stark in Abhängigkeit der Herstellungsart. In
vorangegangenen Arbeiten wurden FSC im Bereich von 28 bis 135 g/g ermittelt. Im
Vergleich zu konventionellen Hydrogelen auf Acrylbasis (FSC ≥ 600 g/g) sind
Kraftligninhydrogele die schwächeren Absorber.
Der Schwerpunkt der Forschung mit Ligninhydrogelen lag zuletzt speziell im Bereich der
Bodenwasserspeicher. Dort weisen Ligninhydrogele eine hohe Stabilität auf.
Sie sind in der Lage die Wasserretention von beispielsweise Sandböden zu
erhöhen, während das Wasser trotz dessen pflanzenverfügbar bleibt. Zusätzlich geben
Ligninhydrogele im Zuge ihrer Zersetzung und Umformung auch Huminstoffe an den Boden
ab.
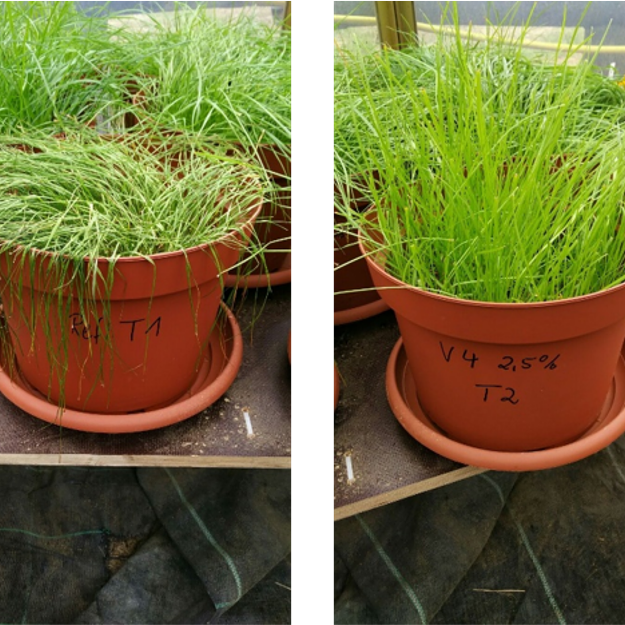
Anwendungsgebiete
Bodenverbesserer
Das Hydrogel speichert Wasser im Boden und setzt sich nach und nach in Huminstoffe um.
Adsorption
Einige Ligninhydrogele sind in der Lage, Schwermetall aus Lösungen zu adsorbieren. Dadurch können belastete Gewässer gereinigt werden.

Aktor/Sensor Systeme
Kraft-Lignin Hydrogele reagieren mit ihrer Quellfähigkeit auf Umwelteinflüsse wie den pH-Wert.
Absorption
Grundsätzlich können auch andere Stoffe in der Gelmatrix eingelagert werden. Dazu gehört auch Schweröl.